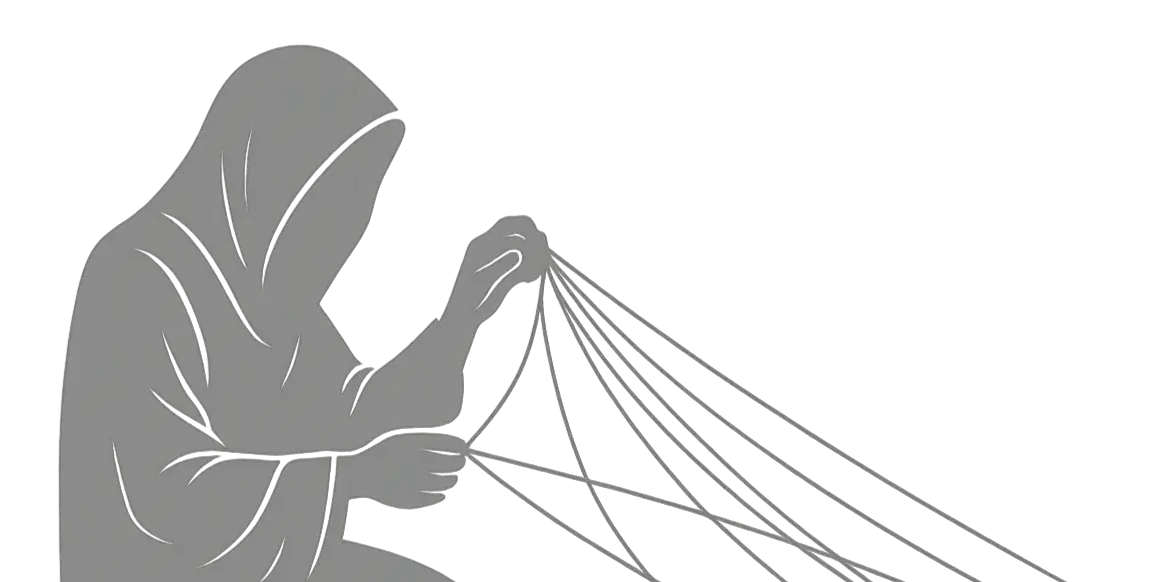Sehnsucht nach dem Unbewussten
Es war nicht der erste Job, den er verlor, aber es war der erste, bei dem er sich dabei nicht einmal mehr wehrte. Die Arbeit hatte ihn nie erfüllt. Sie war eng, stumm, fremdbestimmt. Jeder Tag eine Wiederholung, jeder Gedanke zu groß für das, was man von ihm wollte. Er hatte versucht sich anzupassen. Hatte seine Ideen leiser gedacht, seine Bewegungen reduziert, sein Denken abgedunkelt. Doch wer innerlich zu weit reicht, stößt irgendwann überall an. So kam das Ende nicht plötzlich, sondern wie ein Echo seiner Gleichgültigkeit. Als man ihm kündigte, fühlte er nichts. Kein Schock, keine Wut, nicht einmal Erleichterung. Nur dieses schale Gefühl, dass selbst der Verlust bedeutungslos geworden war.
Es war ein seltsamer Zustand, in dem er lebte. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern zäh. Unsichtbar wie Nebel in einem Raum, den niemand betreten wollte. Die Tage schoben sich dahin, einer wie der andere, wie graue Wolken, die den Himmel verdecken. Morgens stand er nicht auf. Er hörte nur irgendwann auf, zu liegen. Das Sofa war längst keine Sitzgelegenheit mehr, sondern eine Art Gegenwart, in die er fiel, sobald der Körper etwas verlangte, das er nicht benennen konnte. Meist war es nichts. Kein Hunger, keine Müdigkeit, nur ein Abflachen des Bewusstseins, das nicht verging.
Die Stunden verstrichen im blassen Licht des Fernsehers, der fast ununterbrochen lief. Nachrichten, Serien, Dokumentationen über das Weltall oder über das Leben von Menschen, die irgendwie bedeutungsvoll wirkten. Alles rauschte an ihm vorbei. Manchmal fragte er sich, ob überhaupt jemand bemerkte, dass er noch da war. Aber selbst dieser Gedanke hatte keine Schärfe mehr. Es war wie das Summen eines Geräts, das man so lange hört, bis man es nicht mehr bemerkt.
Er hatte einst viel gewusst. Hatte nachgedacht, gelesen, geschrieben. Heute klickte er sich stumm durch Mediatheken, ohne je etwas zu Ende zu sehen. Alles war zu viel, und gleichzeitig nichts. Wenn er auf die Uhr sah, war es plötzlich wieder Nacht. Wenn er aufwachte, war es Nachmittag. Dazwischen: kaum ein Gefühl. Kein Schmerz, keine Wut, keine Freude. Nur eine dumpfe Form von Existenz. In manchen Momenten fragte er sich, ob er dabei war, verrückt zu werden. Aber selbst das klang zu aufregend. Verrücktwerden, das bedeutete Bewegung. Er aber stand. Innen wie außen. Bewegte sich kaum, dachte wenig, spürte noch weniger. Und doch war da etwas.
Ein Bild. Eine Erinnerung. Ein Licht, das sich nicht löschen ließ. Der Traum.
Er war längst vergangen, Monate her. Und doch war er geblieben. Nicht als Handlung, nicht als Geschichte, sondern als Zustand. Als Ahnung von Größe. Von etwas Echtem. Von Bedeutung. Dort, in jenem Traum, war alles anders gewesen. Die Welt hatte geleuchtet. Sie war fremd, groß, lebendig. Und er selbst war jemand gewesen, der eine Rolle spielte. Nicht groß, nicht heldenhaft. Aber echt. Wach. Gegenwärtig. Was war das gewesen?
Er hatte nie zuvor so etwas gesehen. Keine Science-Fiction-Serie, kein Game, kein Gedanke hatte je eine solche Welt hervorgebracht. Der Traum war so vollständig gewesen, so durchdrungen von Atmosphäre, dass ihm jedes Erwachen wie ein Verlust erschien. Doch er hatte ihn fast vergessen. Erst langsam schob sich das Bild wieder in sein Denken. Nicht aus Nostalgie. Sondern aus Verlangen.
Er begann zu suchen. Nicht im Außen, denn er hatte das Haus seit Tagen nicht verlassen., Er suchte dort, wo es kaum noch etwas zu finden gab: In sich selbst. Eine alte Erinnerung tauchte auf. Etwas, das er vor Jahren gelesen hatte. Luzides Träumen. Die Fähigkeit, sich im Traum bewusst zu werden. Damals hatte es ihn fasziniert, aber nie gepackt. Jetzt war es anders.
Er öffnete das Fenster, das er früher nur aus Langeweile nutzte. Früher, wenn ihm nichts Besseres einfiel, wenn er sich treiben ließ in belanglosen Gesprächen oder halbgaren Ideen. Doch diesmal war es anders.
Diesmal war da ein echtes Anliegen. Er tippte langsam, beinahe zögerlich: „Kann man lernen, bewusst zu träumen?“
Die Antwort kam prompt. Klar. Freundlich. Wissend. Wie erwartet. Und doch war es nicht wie sonst. Er blieb. Stellte Fragen. Las. Fragte weiter. Und irgendwann begriff er: Der Weg zurück in die Welt, die ihn nicht mehr losließ, war möglich. Nicht einfach. Nicht sicher. Aber möglich.
Zum ersten Mal seit Wochen verspürte er so etwas wie Richtung. Keine Euphorie. Keine Hoffnung, die aufschrie. Nur ein feiner Riss in der Gleichgültigkeit. Ein leiser Zug, als hätte etwas begonnen, ihn zurückzurufen. Er fing an, sich zu beobachten. Hielt mitten im Alltag inne und fragte sich: Träume ich? Sah auf seine Hände. Zählte Finger. Sah sich im Spiegel an und suchte nach Unstimmigkeiten. Nicht weil er daran glaubte. Sondern weil es einen Weg markierte. Einen kleinen Riss im Gewebe der Gewohnheit.
Er hörte sich Sätze an, die ihn einstimmen sollten, flüsternde Stimmen aus der Stille: „Ich werde mir bewusst, dass ich träume…“
Er lag da, in der Dunkelheit, den Blick zur Decke, und wiederholte sie. Nicht aus Überzeugung. Nicht aus Glauben. Nur aus Ausdauer. Ob es funktionieren würde, wusste er nicht. Aber er wusste, dass ihn das Nichtstun zersetzte. Und wenn er schon träumte, dann wollte er es bewusst tun.
Etwas in ihm spürte: Der Weg führt nicht durch die Tür nach draußen, sondern durch eine andere. Eine Tür in ihm selbst.